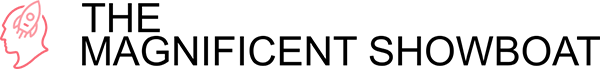Eine Frau aus der sozialen Unterschicht Sydneys wird zum Opfer einer Jagd auf Terroristen. Der traurige, verstörende Roman The Unknown Terrorist von Richard Flanagan ist die bittere Analyse eines menschenfeindlichen »Kriegs gegen den Terror«.
Es gibt Romane, bei denen von Anfang an spürbar ist, dass sie auf üble Weise enden werden. Die Frage ist nur, wie schlimm das Ende sein wird und ob die Geschichte irgendeine Form von poetischer Gerechtigkeit bereithalten wird. The Unknown Terrorist ist der zweite Roman von Richard Flanagan, den ich gelesen habe. Ebenso wie A Narrow Road To The Deep North ist mir diese Geschichte unter die Haut gegangen. Ich kenne nur wenige Autoren und Autorinnen, die so schmerzhaft zupacken können.
The Unknown Terrorist ist die Geschichte der Stripperin und Tabletop-Tänzerin Gina Davies, im Roman und von ihrer Umgebung einfach nur »the Doll« genannt. Abend um Abend stellt sie ihren Körper zur Schau, um sich mit ihrem gesparten Geld irgendwann in den Schutz einer glänzenden Konsumwelt flüchten zu können. Es ist der einzige Schutz, den sie sich erträumen kann: eine Mauer aus Geld, Luxus und Sorglosigkeit. Hinter dieser Mauer, davon ist sie überzeugt, leben die »wirklichen Menschen«, jene, die etwas bedeuten.
The Doll lebt und arbeitet in Sydney. Die Stadt wird von einer Post-9/11-Hysterie beherrscht, in der jedes herrenlose Päckchen ganze Stadtteile lahmlegen kann und jedes weiße Pulver die Furcht vor einem Giftgasanschlag auslöst. Der Roman beschreibt eine unangenehme Atmosphäre aus Islamophobie, Populismus und selbstgefällig zynischen Wirklichkeitsanalysen ruhmsüchtiger Journalisten.
The Doll hat sich eine kleine Welt kleiner Hoffnungen aufgebaut. Nachmittage mit ihrer besten Freundin am Stadtstrand, Momente aus Freude und Vorstadt-Normalität, meistens eingekleidet in einen Schutzschleier aus Beruhigungstabletten, Antidepressiva und Aufputschmitteln. Und doch ist the Doll eine kämpferische Frau, eine, die einfach nur irgendwie durchkommen will. Sie schützt und bewahrt die Gina Davies in ihrem Inneren und hofft auf eine Zukunft, in der sie endlich ein »normales Leben« führen kann.
Die Handlung des Romans umfasst nur vier Tage. Als Gina Davies zusammen mit einem One-Night-Stand auf dem Video einer Überwachungskamera auftaucht, gerät ihr Leben aus den Fugen. Der Fremde, mit dem sie nur eine Nacht verbrachte, wird als Terrorist identifiziert. Die unbekannte Frau neben ihm auf dem Video wird von den panikhungrigen Boulevard-Medien schnell zur Komplizin gemacht, zur »Unknown Terrorist«. Es beginnt eine Hexenjagd, der the Doll völlig hilflos ausgeliefert ist.
Anstatt zur Polizei zu gehen, versucht sie, diesen Irrtum zunächst zu verdrängen. Jemand wie sie hat die staatliche Ordnung und die Polizei niemals als Schutz und Helfer erlebt. In der Welt von Gina Davies ist Unschuld keine relevante Kategorie, denn Gerechtigkeit sieht sie nur bei den Reichen. Wer würde ihr schon glauben? Ihr, der Puppe? Als ihr klar wird, dass sie sich der Situation stellen muss, um das Missverständnis aufzuklären, ist sie bereits tief in eine Menschenjagd verstrickt, in der Schuld oder Unschuld kaum noch eine Rolle spielen. The Doll ist das perfekte Opfer eines Terrorismuswahns, der sich nichts sehnlicher wünscht als einen Feind im Inneren. Gina Davies ist das perfekte Opfer, weil sie ihr ganzes Leben ein Opfer war: von Männern, von Drogen, von einer Gesellschaft ohne soziale Aufstiegschancen.
Worauf die Tragödie von the Doll zusteuert, bleibt bis zum schockierenden Schluss völlig unklar. Zugleich zeigt uns Richard Flanagan die Tragödie einer Gesellschaft, die sich durch Angst und Feindseligkeit beherrschen lässt und dabei genau jene Menschlichkeit verliert, die sie zu verteidigen vorgibt. Ein ergreifender, fesselnder Roman, der mich beeindruckt hat.